|
|
|
DNA-Forschung
Ergebnis Mütterliche Linie
Haplogruppe
T2b - 'Tara'
(Steffan
Lewandowsky)
Herkunft
Die Haplogruppe T ist in der Humangenetik eine
Haplogruppe der Mitochondrien und mit 10 % die 3 häufigste mtDNA
Haplogruppe in Europa. Diese Haplogruppe ist auch in Nordafrika und
dem Nahen Osten verbreitet. In dem Buch 'Die sieben Töchter Evas'
von Bryan Sykes ist die Urmutter dieser Haplogruppe als 'Tara'
bezeichnet. "Tara", bedeutet auf
Gälisch 'die felsigen Hügel'. Sykes ist der Ansicht dass diese
Tara vor 17.000 Jahre in den Hügeln der Toskana und an der Mündung
des Flusses Arno lebte. Andere sehen es deutlich nördlicher, so
südlich oder gar nördlich der Alpen, in Pannonien oder am
Schwarzen Meer. Haplogruppe T wird in Europa derzeit mit hoher
Konzentration in den Niederlanden, in Aragon und der italienischen
Adriaküste gefunden, dies spricht für eine Entstehung im Umfeld
der Alpen, möglicherweise im Raum Saone-Donau. Dies macht die
Haplogruppe T zu einer typischen alteuropäischen Gruppe. Nahe
verwandt mit T scheint auch die Haplogruppe J zu sein.
Verbreitung
Die Haplogruppe T2 ist eine
Untergruppe der Gruppe T, wahrscheinlich sogar die älteste und
relativ weit verbreitet, das Verteilungsmuster gibt aber kaum
Hinweise zur Herkunft. Die Häufigkeit von T wie auch T2 variiert
stark innerhalb der Sprachfamilien bzw. Völker, die sonst hingegen
eine ähnliche Herkunft teilen und sogar zwischen den Regionen des
gleichen Landes. Das einzige einheitliche Muster ist ein deutlich
erhöhter Prozentsatz in allen Balto-Slawischen Ländern (6,5% bis
8,5 %). Es ist interessant und schon fast einzigartig, das die
Haplogruppen J, T, T1 und T2 ein sehr ähnliches Verbreitungsmuster
auf der Welt aufzuzeigen, bei nur mäßigen Unterschieden in den
Verteilungsmustern, ein recht eindeutiger Hinweis auf eine
Jahrtausende alte gemeinsame Koexistenz dieser Haplogruppen.
Es ist wahrscheinlich, dass der
Ursprung von T2 irgendwo zwischen Alpen und Schwarzen Meer zu suchen
ist und wohl in der Mittelsteinzeit entstand, nur relativ kurz nach
de Entstehen der Hauptgruppe T. In der Jungsteinzeit dürfte es sich
dann von dort aus auch auf den Rest von Europa, Zentralasien und
Nordasien ausgedehnt haben. Möglicherweise können einige Subclades,
wie T2b und T2e, mit den Indoeuropäern verknüpft werden. T2 kommt
auch in Zentral-und Nordasien vor. Es gab offensichtlich in der
Bronzezeit oder auch schon davor, Verbindungen von den
Indoeuropäern zu den Völkern in Sibirien, Kasachstan, ja gar bis
zur Mongolei.
T2 hat in allen großen Kulturen der
Jungsteinzeit in Europa (Starčevo, LBK, Cucuteni-Trypillian,
Cardium Keramik, Atlantische Megalithkultur) gefunden, aber wie
Haplogruppe J könnte es in Südosteuropa seit der Mittelsteinzeit
präsent sein. Die höchsten Frequenzen von T2 sind unter den
Udmurten (23,8 %), einer uralischen Population aus der Wolga-Ural-
Region und den Tschetschenen (12,5%) im Nordkaukasus beobachtet. In
der westlichen Hälfte Europas ist T2 über 10% nur in den
Niederlanden, Island, Aragon, Sardinien, Kalabrien und der
Adriaküste in Italien verbreitet. T2 ist in Cornwall und der Saami
Bevölkerung praktisch nicht vorhanden. Dies spricht für eine
Entstehung von T2 eher am Schwarzen Meer und kann ein weiterer Beleg
für einen Zusammenhang mit der Verbreitung der Indoeuropäer, wohl
mehr aber noch mit der nordischen Rasse sein. Denn die Haplogruppe
T2 war auf jeden Fall schon in der Jungsteinzeit in Europa und
Mittelasien verbreitet. Von 101 mtDNA-Proben des neolithischen
Deutschland hatten 17,8 % die Haplogruppe T, von denen alle die
Subgruppe T2 besaßen – heute ist es nicht mal die Hälfte, wobei
auch T selbst vorhanden ist.
T2 ist in viele Untergruppen von T2a
bis hin zu T2L unterteilt. Die mit Abstand größte ist T2b, welche
30 Untergruppen der eigenen, und weiterer nachfolgender Clades hat.
Die ehemalige Subclades T3, T4 und T5 sind nun alle unter T2 (
jeweils T2c1a , T2a1b und T2e ) notiert.
Die geographische Verteilung
innerhalb der Subclade T2 variiert stark mit dem Verhältnis von
Subhaplogruppen T2e zu T2b, 40-fach in der untersuchten Populationen
von einem niedrigen in Großbritannien und Irland, zu
einem hohen in Saudi-Arabien. Die Subhablogruppe T2e ist leicht
gehäuft unter den sephardischen Juden der Türkei und Bulgariens
vertreten und es gibt den Verdacht Conversos aus Spanien, welche
selbst iberische bzw. (indo-)germanische Vorfahren hatten, hätten
diese eingeführt.
Gesundheitsrisiken
Eine Studie hat gezeigt, dass die Haplogruppe T mit
einem erhöhten Risiko für koronare Herzerkrankungen einhergeht.
Anderseits sind Menschen dieser Haplogruppe wohl weniger anfällig
für Diabetes. Weitere medizinische Studien scheinen aufzuzeigen,
dass die Haplogruppe T einen gewissen Widerstand gegenüber der
Parkinson-Krankheit und Alzheimer-Krankheit bietet.
Außerdem ist mit einer eingeschränkten
Beweglichkeit der Spermien bei Männern zu rechnen, obwohl diese
Ergebnisse von anderen Forschern angefochten werden, stellt
Haplogruppe T zumindest einen schwachen genetischen Hintergrund zu
der Asthenozoospermie dar.
Berühmte
Träger
Der letzte russische Zar , Nikolaus II. besaß die
Subclade T2, unter der Annahme das alle relevanten Stammbäume
korrekt sind, sind das alle weiblichen Vorfahren des Zaren bis hin
zu Barbara von Cilli (1390-1451), der Frau des römisch-deutschen
Kaiser Sigismund. Dies beinhaltet eine große Anzahl des
europäischen Adels, darunter Georg I. von Großbritannien und
Friedrich Wilhelm I. von Preußen (durch die Kurfürstin Sophie von
Hannover), Charles I von England, George III des Vereinigten
Königreichs, George V des Vereinigten Königreich, Charles X.
Gustav von Schweden, Gustav Adolf von Schweden, Moritz von Nassau,
Prinz von Oranien, Olav V von Norwegen, und Georg I. von
Griechenland. Aber natürlich nicht nur der Hochadel hat diese
Subclade, sondern auch 'Normalos', einer dieser war der Westernheld
Jesse James.
|
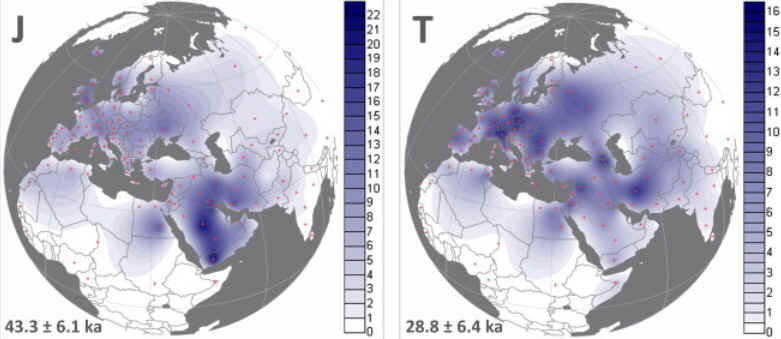
Verbreitung
Haplogruppe J und T |
|
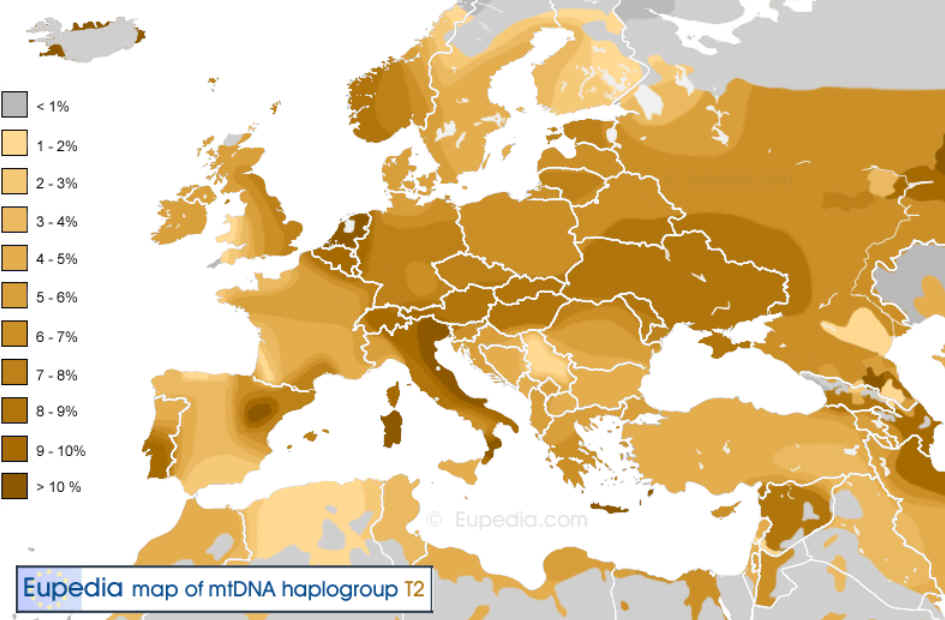
Verbreitung
T2 in Europa |
|
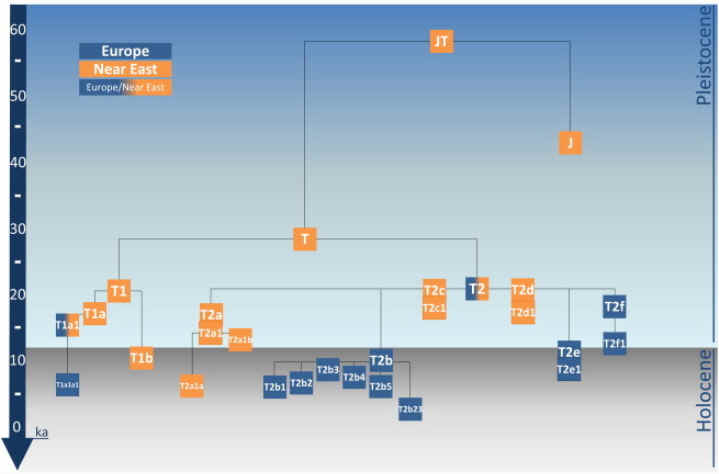
Evolution
Haplogruppe T |
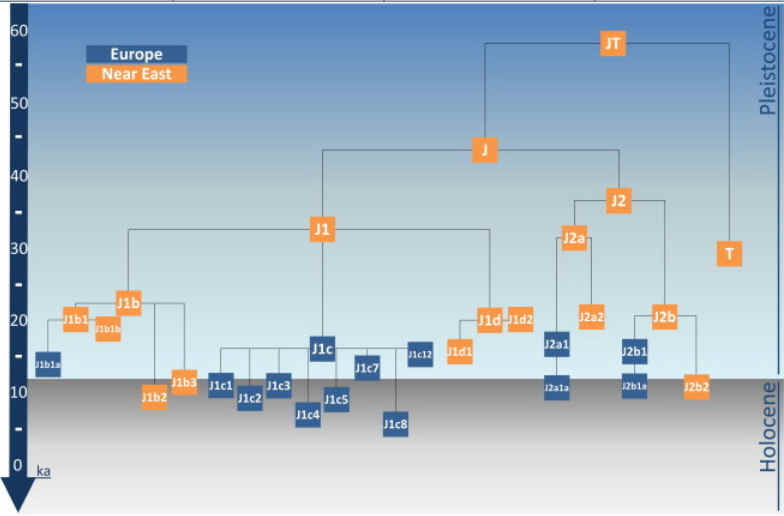
bzw. J |
|
|
|