|
|
|
DNA-Forschung
Mütterliche Linie - mtDNA
Erklärung
Als mitochondriale DNA, kurz mtDNA,
manchmal auch als Chondriom bezeichnet, wird die zumeist zirkuläre,
doppelsträngige DNA im Inneren (Matrix) der Mitochondrien
bezeichnet. Die mtDNA wurde 1963 von Margit M. K. Nass und Sylvan
Nass mit elektronenmikroskopischen Methoden und 1964 von Ellen
Haslbrunner, Hans Tuppy und Gottfried Schatz aufgrund biochemischer
Messungen entdeckt.
Die humane mtDNA besteht aus 16.569 Basenpaaren mit 37 Genen (13
mRNAs (codieren für Protein-Untereinheiten der
Atmungsketten-Komplexe I, III, IV und V), 22 tRNAs und zwei rRNAs
(12S und 16S rRNA)). Die mtDNA besitzt 100–10.000 Kopien pro Zelle
mit 10–15 Molekülen pro Mitochondrium.
Eigenschaften
Die mtDNA vielzelliger Organismen ist meist zirkulär organisiert,
d. h. sie besteht aus einem, zu einem Ring geschlossenen
DNA-Doppelstrang. Nur einfache mehrzellige Organismen wie einige Grünalgen
besitzen linear organisierte mtDNA. Auf der mtDNA befinden sich
einige, wenn auch nicht alle, Gene für die Enzyme der Atmungskette
sowie Gene, die für die Struktur und Reproduktion der Mitochondrien
verantwortlich sind.
Die mtDNA ist innerhalb der Matrix in sogenannten Nucleoiden
organisiert, einem Zellkernäquivalent, wie es auch bei Prokaryoten
zu finden ist. Diese enthalten sowohl die Nukleinsäure als auch
Proteine.
Ursprung
Das Vorhandensein einer eigenen DNA ist einzigartig unter den
Zellorganellen der Tiere, bei den Pflanzen besitzen die
Chloroplasten dieselbe Eigenschaft. Dies ist Ausgangspunkt für die
Endosymbiontentheorie, die besagt, dass Mitochondrien und
Chloroplasten ursprünglich eigenständige Organismen waren, die im
Laufe der Evolution in tierische bzw. pflanzliche Vorläuferzellen
inkorporiert wurden und nun bestimmte Aufgaben für diese Zellen übernehmen.
Weitere Indizien hierfür sind, dass Mitochondrien in etwa die
gleiche Größe wie kleine Bakterien haben, eine zirkuläre DNA
besitzen und von zwei Membranen umgeben sind. Auch ist die
Proteinsynthesemaschinerie (z. B. Ribosomen) der Mitochondrien der
von Prokaryoten sehr ähnlich. Überdies enthält mtDNA, ähnlich
wie bakterielle DNA keine Histone und kaum Introns.
Vererbung
In der Genealogie und Anthropologie spielt die Vererbung der
mtDNA eine große Rolle. Dies hat einerseits damit zu tun, dass
Mitochondrien bei vielen Organismen nur maternal, also nur von der
Mutter, an die Nachkommen weitergegeben werden. Die Mitochondrien
des Spermiums befinden sich in dessen Hals, der nur teilweise an der
Verschmelzung des Spermienkopfes mit der Eizelle teilnimmt. Außerdem
sendet die Eizelle Stoffe aus, die die Mitochondrien des Spermiums
auflösen. Genauer gesagt, sie werden mit Ubiquitin markiert und
anschließend abgebaut. Zudem mutiert mtDNA mit einer sehr
konstanten Rate, sodass man relativ genau sagen kann, wie nah
(zeitlich gesehen) zwei Volksstämme verwandt sind, d. h. wann sich
die Vorläufer dieser Stämme trennten. In der Anthropologie konnte
so gezeigt werden, dass die amerikanische Urbevölkerung am engsten
mit der Urbevölkerung Eurasiens verwandt ist (also von einem
gemeinsamen Vorläufer abstammt); außerdem konnten Hypothesen über
die Ursprünge des Jetztmenschen (Mitochondriale Eva) bestätigt
werden. Das 2005 gestartete Genographic-Projekt, welches Erbgut von
Menschen auf allen Kontinenten mit dem Ziel untersucht, genauere
Erkenntnisse über die Verwandtschaftsbeziehungen der verschiedenen
Bevölkerungen sowie den Ablauf der Besiedlung der Erde durch den
Homo sapiens zu gewinnen, macht sich diese Eigenschaften der mtDNA
zu Nutze.
Neandertaler-mtDNA
Svante Pääbo gelang es 2008, das mitochondriale Genom eines
Neandertalers (Homo neanderthalensis), der vor 38.000 Jahren lebte,
vollständig, mit einer bisher nicht erreichten Genauigkeit, zu
sequenzieren.
|
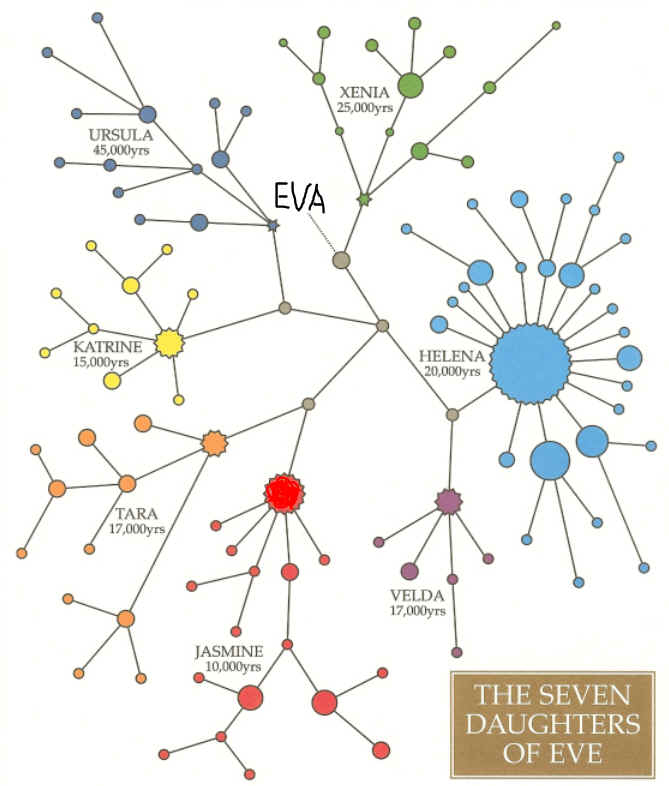 Evolution
der mtDNA (Eva's sieben Töchter) Evolution
der mtDNA (Eva's sieben Töchter)
|
|
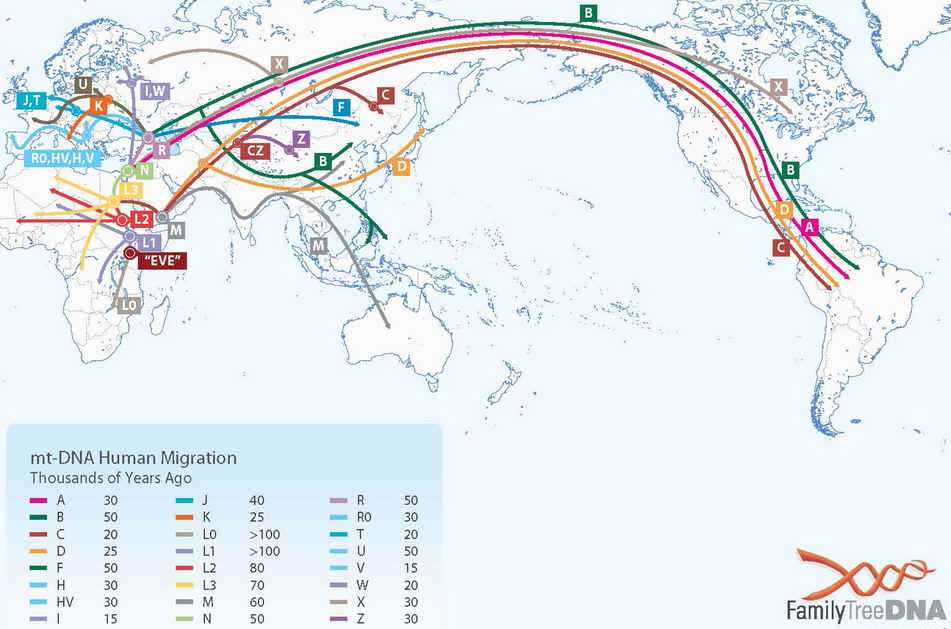
Verbreitung mtDNA |
|
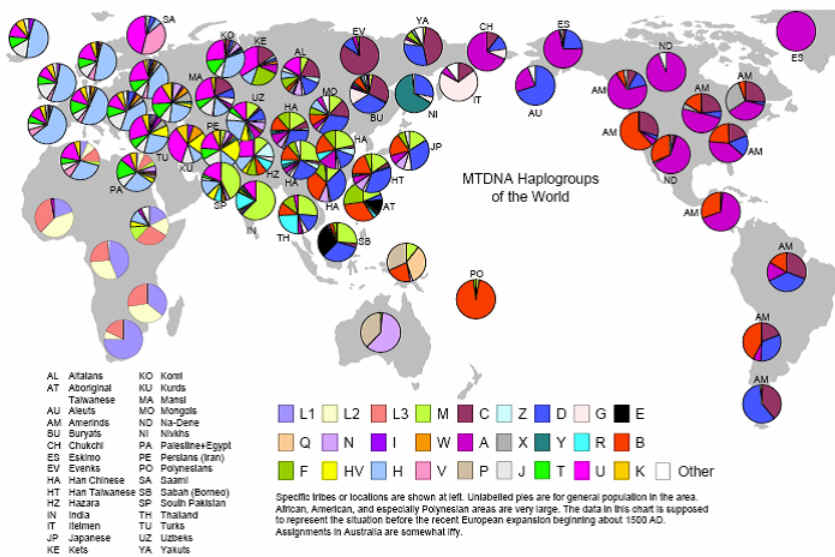
Verbreitungsmuster mtDNA |
|
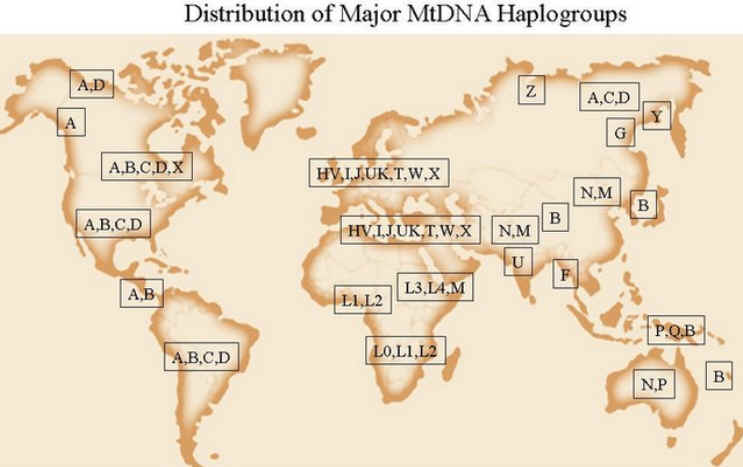
Regionale Hauptgruppen |
|
|
|